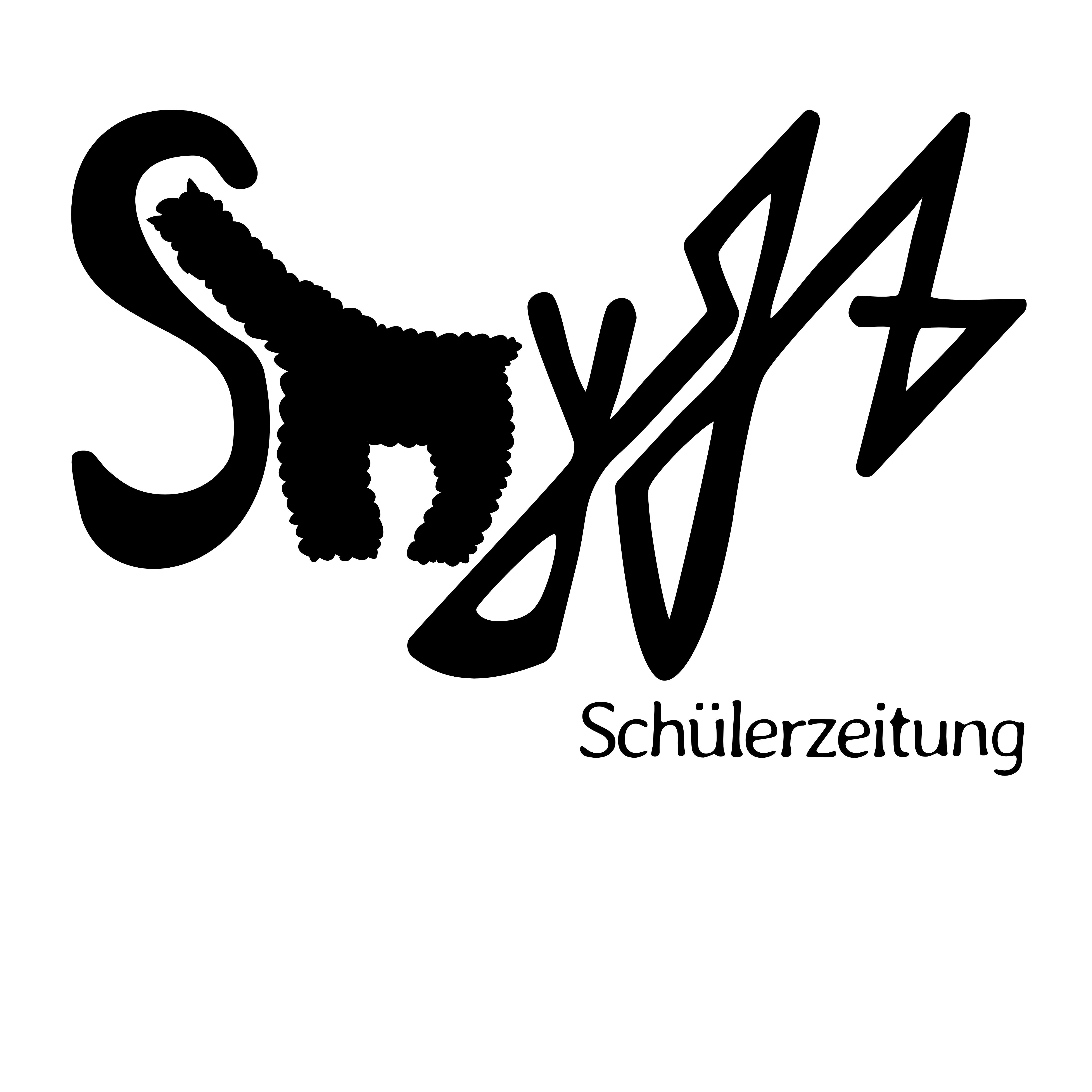Filmkritik: Fruitvale Station

Kann ein reales Gewaltverbrechen in Form eines Spielfilms angemessen verarbeitet werden?
Die drei Englischleistungskurse aus dem zweiten Semester sind mal wieder gemeinsam unterwegs: Eine Exkursion ins Kino, doch worum es in dem Film überhaupt geht, weiß keiner. Es ist schließlich schon schwer genug, den ulkigen Titel zu behalten.
Nachdem auch sämtliche Zuspätkommer eingetroffen sind (und den Pünktlichen bereits die einen oder anderen Gliedmaßen abgefroren sind), trotten wir im Gänsemarsch und ohne eine Idee, was uns erwartet, in den menschenleeren Kinosaal.
Ein verpixeltes, verrauschtes Handyvideo, wackelig gefilmt und mit kaum erkennbaren Bildern, flackert über die Kinoleinwand. Ein Tumult – Eine Schlägerei? – Menschen laufen hin und her, Menschen rufen, Menschen sitzen, Menschen stehen, Menschen zerren aneinander. Noch ehe man die Bilder im Kopf zusammenfügen kann, fällt ein Schuss. Stille. Eine schwarze Leinwand. Dann wird ein Filmtitel eingeblendet: Fruitvale Station.
Ein Pärchen beim Tête-à-tête auf dem Bett, er ganz verrückt nach ihr, sie abweisend: “Woher soll ich wissen, ob du es wirklich nur einmal mit dieser Bitch getrieben hast?” – So beginnt die Geschichte von Oscar und Sophina. Der Film erzählt das mehr oder weniger alltägliche Schicksal einer Familie aus der unteren Mittelschicht: Kind in den Kindergarten bringen, zur Arbeit fahren, Essen bei Oma. Rückblenden zeigen Oscar ein Jahr zuvor, als Häftling im Streit mit einem Insassen. Konflikte durchbrechen die scheinbar harmonische Oberfläche: Oscar verliert seinen Job, flirtet mit anderen Frauen, verkauft Drogen, sitzt später ratlos am Strand und lässt das Marihuana in die Wellen rieseln…
Nichts scheint auf den Punkt, auf den letztendlich alles hinauslaufen muss, hinzudeuten, während sich kleinere und größere Dramen am Rande der Handlung abspielen. Nach und nach gerät der Zuschauer in diesen Rausch, den Rausch des gemächlich verstreichenden Lebens, dass sich da vor seinen Augen abspielt. Und dann, wenn das Handyvideo vom Anfang schon fast vergessen ist, wenn man vom Scheitel bis zur Sohle in diesem fremden Schicksal steckt, wenn es nichts Wichtigeres mehr gibt als den Beziehungsstress zwischen Oscar und Sophina und der Frage, ob Oscar nun einen Job bei seinem neuen Freund Peter bekommen wird – dann reißt sie einen aus dieser Scheinwirklichkeit, die Realität, das unvermeidliche Ende.
Ein Ruf, eine Schlägerei, Sicherheitsbeamte zerren Oscar aus der Bahn, Schläge, Gerangel, eine weinende Sophina am Telefon, ein Schuss: “Sagt mir, was los ist! Sagt mir, wo Oscar ist!”. Eine Trage wird herangerollt, Oscar liegt in einer Blutlache, neben ihm kniet ein verzweifelter Polizist. Den Schuss – behauptet er – hat er nicht absichtlich abgegeben. Im Krankenhaus ein kurzer Hoffnungsschimmer: Weniger für die Protagonisten, als für das Publikum. Der Satz “Er hat es nicht geschafft.”, rührt einige Mitschülerinnen zu Tränen.
Große, rehbraune Augen und ein rundes Kindergesicht: “Wo ist Daddy?”, fragt Oscars kleine Tochter Tatiana, dann ist der Film zu Ende. Es folgt eine kurze Information: Dieser Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Oscar Soundso wurde in der Silvesternacht vom Soundsovielten in San Francisco von einem Polizisten erschossen. Dieser wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt und kam nach elf Monaten Haftstrafe wieder frei. Der Fall löste landesweite Proteste und scharfe Kritik gegenüber der amerikanischen Polizei aus.
Und das war der Moment, in dem das gesamte Konzept dieses Films vor meinen Augen ins Wanken geriet. Ich muss gestehen, dass ich mit Filmen, die auf wahren Begebenheiten, insbesondere auf wahren Gewaltverbrechen basieren, so meine Probleme habe. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine Geschichte wie diese in Form eines Spielfilms auch nur annähernd authentisch wiedergegeben werden kann. Allein mit der Wahl der Schauspieler, dem Füllen der durch ungeklärte Sachverhalte im Drehbuch entstandenen Lücken, geht eine allgegenwärtige Verfälschung der Tatsachen einher. Dass die Lebensgeschichte real existierender, lebendiger Menschen hier in Form eines Spielfilms abgedreht wurde, erscheint mir im ersten Moment wie die äußerste Perversion unserer sensationsgeilen Gesellschaft. Reicht es nicht, zu wissen, was an diesem Tag vorgefallen ist? Reicht es nicht, dass es Handyvideos von der Tötung Oscars überall im Internet zu sehen gibt, (die sich anzusehen wohl nicht minder moralisch verwerflich ist)? Reicht es nicht, dass die Hinterbliebenen Oscars von allen Seiten mit Fragen bestürmt und in den Nachrichten gezeigt werden? Warum müssen wir das Schicksal einer trauernden Familie ins Licht der Leinwand zerren?
Kleinen Kindern bringt man bei, nicht hinzustarren, wenn man mit dem Auto an einer Unfallstelle vorbeifährt. (Nun, zumindest mir wurde das so beigebracht), um niemanden zu belästigen. Warum aber dürfen wir dann die Geschichte einer Gewalttat so dermaßen ausreizen und mit kullerigen Kinderaugen auf die Tränendrüse drücken? Ist das nicht ein bisschen über das Ziel des Erinnerns, des Bewusstmachens der Missstände unserer Gesellschaft, hinaus geschossen? Ist das noch guter Wille oder schon Geldmacherei?
Letztendlich ist es wohl ersteres, aber nur gerade eben so. Würde dieser Film auf RTL laufen, hätte ich ihn als widerliche Sensationsvermarktung abgetan. Aber sieht man ihn sich an, so überwiegt doch die Tatsache, dass es sich schlichtweg um ein einzigartig kreatives Kunstwerk handelt. Das ist keine schnöde Dokumentation, sondern ein mitreißendes und emotionales Meisterwerk, dass Empathie wachruft, auf eine so einfühlsame, geschickte Weise, wie man es doch selten erlebt. Nicht umsonst wurden Fruitvale Station schließlich zahlreiche Auszeichnungen verliehen, unter Anderem der Grand Jury Prize und der Publikumspreis für U.S. Dramatic Film auf dem Sundance Film Festival 2013, wo er debütierte.
Trotz alledem wäre ein bisschen mehr Abstraktion wohl angebracht gewesen. Mehr Spiel mit Namen, Umständen und ethnischen Zugehörigkeiten hätten das Werk nicht nur vom Verdacht der Verharmlosung befreit, sondern vor allem auch die Allgemeingültigkeit der Problematik verdeutlicht.
Lisa Starogardzki, 2. Semester, März 2015